Flucht aus Vietnam:
mit dem Boot nach Hamburg
Der Vietnamkrieg tötete Millionen von Menschen.
In Deutschland verlieben sich die Geflüchteten.

Vu Vuong Pham und Mai Nguyen ließen in den 1980ern ihre Heimat hinter sich. Ihre Wege kreuzten sich tausende Kilometer weiter.
In der Nacht, in der Vu Vuong Pham floh, leuchteten die Sterne und das Meer. Der damals 10-Jährige kauerte auf einem hölzernen Fischerboot und ließ den Blick über das Wasser wandern, über die tanzenden Tiere, die unter der Oberfläche funkelten. „Ich wusste nicht, dass ich Vietnam für immer verlassen würde“, sagt Pham heute.
Knapp dreißig Menschen sind in jener Nacht, 1986, an Bord des Flüchtlingsboots in Ba Ria. Der Krieg ist vorbei, trotzdem wollen sie weg. Sie fliehen vor dem Kommunismus und zählen zu den knapp 38.000 Boatpeople, die in Deutschland Asyl finden werden.
Pham fallen nicht die Wellen auf, die gegen das Boot peitschen. Oder die angsterfüllten Gesichter um ihn herum. Er vergisst beim Anblick des schillernden Planktons die Guerilla-Banden, die in seinem Dorf, Lac Son, hingerichtet wurden, und die Piraten auf hoher See.
„Wir waren nicht die ersten aus meiner Familie, die die Flucht ergriffen haben“, sagt Pham. „Meine Großeltern sind kurz nach Teilung des Landes in den US-besetzten Süden geflohen.“ Weil er der älteste Sohn ist, wird er mit einem Cousin und zwei Onkeln losgeschickt.
Angst habe er keine gehabt. „Die Teilung hat viele Menschen entwurzelt. Meine Familie ist danach oft umgezogen. Ich habe mir als Kind nicht viel dabei gedacht.“
Pham wächst unbeschwert auf, weil er nach dem Vietnamkrieg geboren wurde. Die Schlachten sind bloß Geschichten für ihn, die Gewalt reine Vorstellung. Es gibt keine Erinnerungen, die ihm in den Schlaf folgen und schmerzhafte Träume bereiten.
Wenn Mai Nguyen* träumt, wacht sie manchmal schreiend auf. Die gebürtige Chinesin erinnert sich an den Krieg und an ihr Leben davor. Und an die Hiebe, die sie als Kind und als Ehefrau bekam. An ihren eigenen Geburtstag erinnert sie sich nicht. „Ich habe keine Fotos und keine Papiere aus meiner Kindheit“, sagt sie.
Zwei Dekaden lang bekriegten sich Kommunisten, Südvietnamesen und US-Amerikaner. Der Vietnamkrieg wurde von etwa 1955 bis 1975 geführt. Das spendenfinanzierte Hospitalschiff Cap Anamur rettete in den Jahren darauf rund 40.000 sogenannte Boatpeople aus dem Südchinesischen Meer.
Während die geflüchteten Menschen in den 70er- und 80er-Jahren in Westdeutschland unterkamen, reisten Zehntausende Arbeitskräfte aus dem kommunistischen Nordvietnam über Verträge in die DDR ein.
Viele von ihnen haben in Deutschland zusammengefunden. Pham wird Nguyens Tochter erst Jahre nach der Flucht begegnen.
Kindheit bedeutet für Nguyen Arbeit. Auf den Süßkartoffelfeldern, in der Weberei oder auf dem Nachhauseweg. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie noch in einem kleinen Haus in der Nähe von Hongkong. Wenn sie von der Arbeit kommt, sammelt sie Blätter und legt sie in die Sonne, damit ihre Familie ein kleines Feuer anzünden kann. Nguyen ist erst vier Jahre alt, als sie beginnt, zu arbeiten.
„Unsere Familie war sehr arm“, sagt Nguyen. „Meine Mutter war krank und meine große Schwester hat mich ständig geprügelt.“ Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Er verschwand während eines Kriegseinsatzes.
Als ein chinesischer Menschenhändler 1944 ihrer Mutter anbietet, die Tochter als Arbeiterin in Vietnam aufzunehmen, willigt die überforderte Frau ein. Nguyen wird im Alter von fünf Jahren weggeschickt. Über 1.500 Kilometer legt sie auf der Reise allein zurück. Das ist eine Strecke vergleichbar mit einer Reise von Berlin nach Moskau.
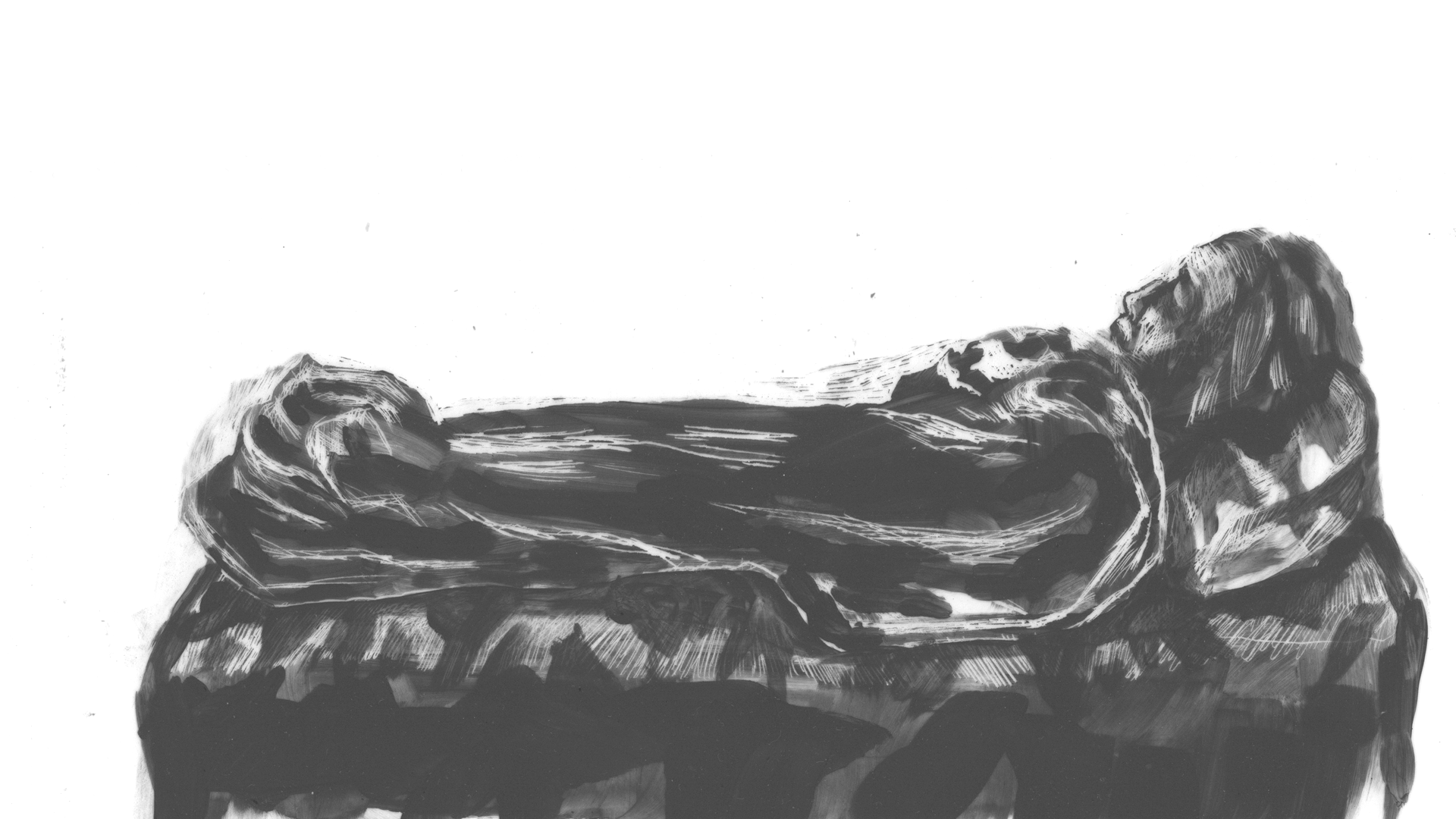
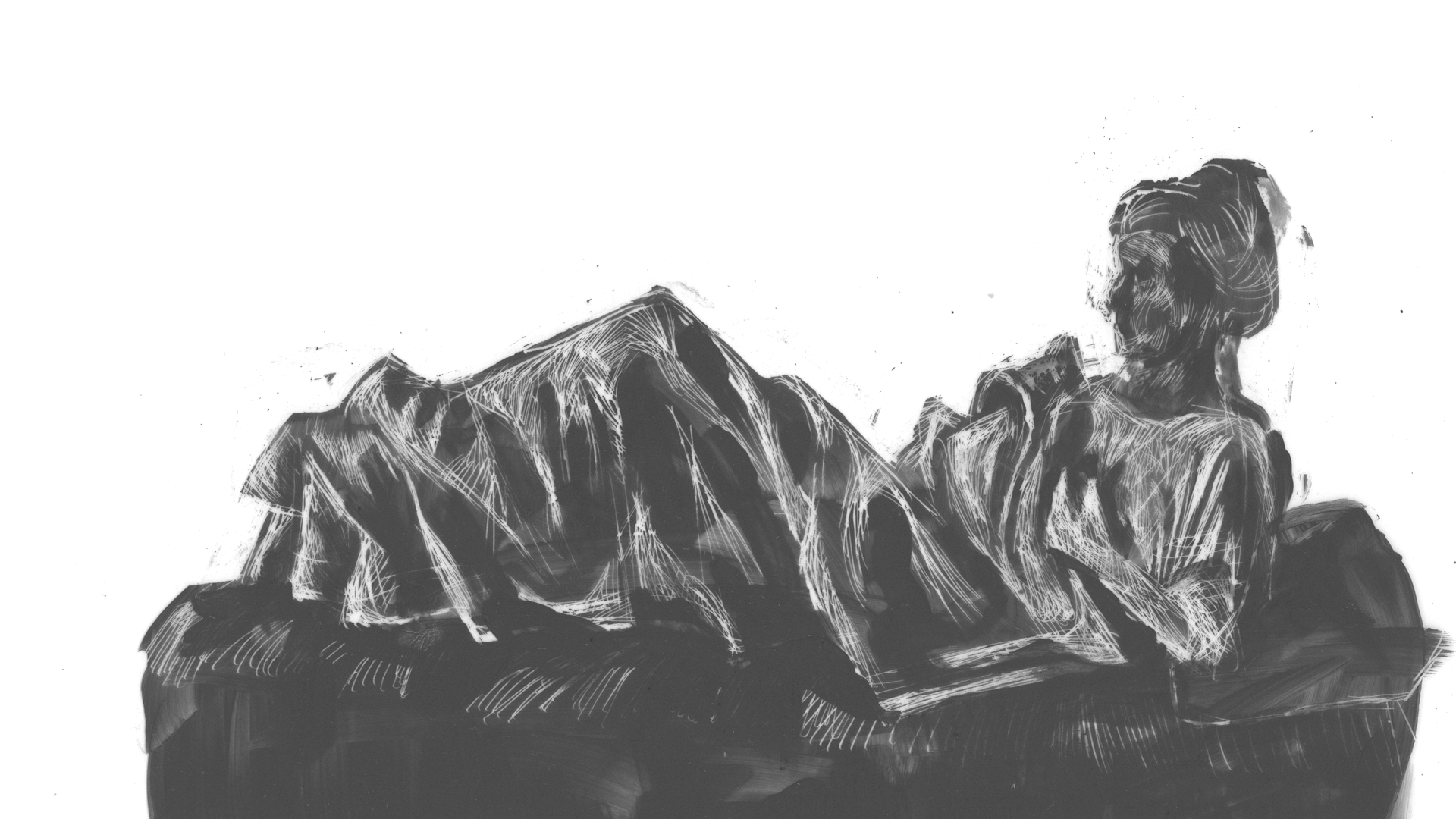

"Ich habe viel geweint, meiner Mutter aber keinen Vorwurf gemacht. Sie hatte keine andere Wahl.
Es gab keine Perspektiven zuhause. Wir waren zu arm, um zu leben."

Französische Kolonialzeit



Die Stadt, in der sich Nguyen niederlässt, ist mit pastellfarbenen Kolonialbauten gepflastert. Pompöser Stuck dominiert dort die einfachen Häuser, in denen die vietnamesischen Einwohner leben. Beim Einkaufen laufen schick gekleidete Französinnen und Franzosen an armen Menschen vorbei, die auf dem Bordstein kauern und Früchte verkaufen.
„In Saigon war es sehr hart. Ich habe für die Frau des Chinesen gearbeitet, aber sie hat mir keinen Lohn gezahlt. Morgens bis abends habe ich Wasser geschleppt und Kleidung und Geschirr gewaschen“, sagt Nguyen. Dann fügt sie hinzu: „Ich wurde geschlagen. Tag für Tag.“
Irgendwann bricht Nguyen bei der Arbeit zusammen. Sie landet im Krankenhaus und befindet sich für Wochen im Delirium. Als sie wieder gesund wird und zu der Familie zurückkehrt, verstößt diese das Kind. „Ich wusste nicht wohin mit mir“, sagt Nguyen.
Sie hat dennoch großes Glück: Die französischen Nachbarn werden auf sie aufmerksam. Das Paar, ein aus Indien stammender Mann und seine Ehefrau, sind die ersten Franzosen, die Nguyen aufnehmen. Für zwei weitere französische Familien wird sie die Jahre darauf noch als Kindermädchen arbeiten.
Nicht alle Menschen freuen sich über die französischen Familien in Saigon. Für viele ist die Kolonialmacht Sinnbild der Unterdrückung. 1946 kommt es zum Indochinakrieg zwischen dem französischen Militär und den kommunistischen Widerstandskämpfern. Die Guerillagruppe wird von einem Mann angeführt, der sich mit seinen Funktionären in den Bergen versteckt: Ho Chi Minh.
Vietnam wird infolge des Krieges entlang des 17. Breitengrads geteilt. Auf der Indochinakonferenz 1954 beschließen die Streitmächte, die Gewalt zu beenden und den Norden in kommunistische Hände zu übergeben.
Doch die USA befürchten eine Niederlage im Kalten Krieg. Es dauert nicht lang, bis sie die US-Truppen in Saigon aufstocken.
Nguyen hat miterlebt, wie die Franzosen abzogen und die US-Soldaten den Krieg fortsetzten. Sie hat gesehen, wie ihr Haus Feuer fing, nachdem ein benachbartes Militärlager in Brand gesteckt wurde. Und sie hat die Bomben gehört, die nur wenige Straßen weiter Menschen unter Schutt und Asche begruben.
Sie hatte trotzdem Glück im Unglück. In Saigon wurde das Grundwasser nicht mit Agent Orange verseucht, dem gefährlichen Herbizid, das Dschungel entlaubt und Ernten vernichtet. In Saigon verbrannten auch keine Kinder in Napalm.
Ob sie jemals darüber nachgedacht habe, die Stadt während des Krieges zu verlassen? „Nein. Wohin sollte ich denn gehen? Es konnte jederzeit jeden treffen. Wir haben bloß versucht, irgendwie weiterzuleben.“
Als ihr damaliger Mann 1964 in den Krieg berufen wird, ist Nguyen mit ihrem zweiten Kind schwanger. Vier weitere gebärt sie noch während des Krieges. Ihren ältesten Sohn Hoang schickt sie kurz vor seinem 18. Geburtstag aufs Meer, damit dieser nicht für die Kommunisten in Kombodscha kämpfen muss.
„Ich habe den Schleppern ein Vermögen gezahlt“, sagt Nguyen. Sie spricht von drei Stangen Gold, je 37,5 Gramm schwer. Ein großer Teil ihres Ersparten.
Hoang hat Glück. Die Flüchtlinge werden von der Cap Anamur entdeckt und nach Malaysia gebracht. Von dort aus versucht Hoang, zu ein paar Verwandten in die USA zu flüchten, doch er hört, dass die Register voll sind. Stattdessen trägt er sich in ein anderes Land ein. Drei Jahre später zieht Hoangs Familie nach.
Nguyen kommt an einem warmen Augusttag 1984 in Frankfurt am Main an. „Es war reiner Zufall, dass wir in Deutschland gelandet sind“, sagt sie heute.

Nguyen mit ihrer Familie. Das Foto entstand zwischen 1971 und 1972.
Nguyen mit ihrer Familie. Das Foto entstand zwischen 1971 und 1972.
Die Flucht

Auch Pham riskiert die Flucht übers Meer. Allerdings erst zwei Jahre später als Nguyen.
Für die Flucht bereitet sich Phams Familie monatelang vor: Die Eltern ziehen mit ihm und seiner Schwester an ein Flussufer und leben in einer kleinen, windschiefen Hütte. Mit einem kleinen Handwurfnetz fährt Phams Vater zum Fischen raus.
Die Beschäftigung dient ihnen als Alibi. Nachts rüstet er das Boot für die Flucht.

„Am Tag der Flucht hat mein Vater mich zum Fischen mitgenommen“, sagt Pham.
Beide fahren zunächst die übliche Route auf dem Fluss, biegen dann aber ab in einen Mangrovenwald. Ungestüme Sträucher und Wurzeln wuchern dort aus dem Wasser. Der Vater versteckt den Jungen zwischen dem holzigen Gestrüpp, weitere Verwandte stoßen über den Tag verteilt hinzu. Erst in der Nacht trauen sie sich heraus. Pham blickt kurze Zeit später auf ein kleines, hölzernes Fischerboot.
„Es war keine zwölf Meter lang. Eine Nussschale“, erinnert er sich. Mit dieser „Nussschale“ stoßen die 30 Flüchtlinge auf hohe See. Ein paar Tonnen Wasser und Wurzeln haben sie als Reiseproviant dabei, mehr nicht. „Die Flucht war sehr schlecht geplant“, sagt Pham. Von dem Rettungsschiff Cap Anamur wissen sie zum Zeitpunkt der Flucht nichts.
Als das schlanke Schiff mit den gelben Masten am nächsten Morgen im Meer erscheint, geraten die Flüchtlinge in Panik. Zu groß ist die Angst, dass es sich um eine sowjetische Besatzung oder Piraten handeln könnte, die im Chinesischen Meer Boatpeople abfangen.
„Wir hatten keine Ahnung, dass es Ausländer gab, die nach Menschen wie uns Ausschau hielten. Erst als wir sie durch das Megafon sprechen hörten, haben wir verstanden, dass sie uns helfen wollten.“
Pham wird an Deck versorgt und medizinisch untersucht, blonde Arzthelferinnen impfen ihn. Der kleine Junge aus Lac Son macht große Augen. „Ich dachte, es wären Engel“, sagt Pham. „Helle Haare und blaue Augen kannte ich als Kind nur aus den Bibelbüchern.“
Bis heute nennt Pham Kapitän und Cap Anamur-Gründer Rupert Neudeck einen Helden. Ohne die Cap Anamur, sagt er, wäre seine Gruppe möglicherweise ertrunken oder verhungert. Neudeck und seine Frau Christel Neudeck hatten aller Kritik und Beschwerden zum Trotz die Seenotrettung initiiert und verteidigt.
Heimat

Mittlerweile lebt Pham in der Nähe von Köln. Wie viele andere Boatpeople wurde er nach Ankunft in Hamburg nach Nordrhein-Westfalen verwiesen. Durch Phams Anspruch auf Familiennachzug durften seine Eltern und Geschwister nachreisen. „Wenn man sich Nacht für Nacht nach seinen Eltern sehnt, ist der Kummer groß. Das Gefühl beim Wiedersehen war unbeschreiblich.“
In Deutschland habe er als Kind schnell seinen Anschluss gefunden, sagt Pham. Er erinnert sich an die Nachmittage im Wald, die er und sein damals bester Freund Christian nach der Schule verbracht haben. Und an sein späteres Studentenleben in Dortmund. Heute arbeitet Pham als Informatiker in einer IT-Firma. An freien Abenden trinkt er mit seinen deutschen Nachbarn Tsingtao und Reißdorf Kölsch.
Viele der vietnamesischen Personen in seinem Alter, sagt er, blieben gerne unter sich. „Es liegt nicht an einem mangelnden Willen zur Integration. Die Leute sind schlichtweg zu schüchtern.“ Besonders bei älteren und kranken Menschen, die fern von ihrer Community leben, sei das Risiko hoch, dass sie vereinsamen.
Die vietnamesische Diaspora in Deutschland ist sonst gut vernetzt: Man organisiert sich überregional auf Online-Plattformen und trifft sich zu feierlichen Anlässen wie dem chinesischen Neujahr.
Nicht selten mietet die Gemeinschaft dafür Sporthallen in Städten wie Herne und Hannover; dann riecht es nach gedämpften Teigtaschen, und Wölbbrettzithern schallen durch die Straßen. Auf den Parkplätzen winken Verkäufer, um heißbegehrte Enteneier zu verkaufen.
Auch die Pfade von Pham und Nguyens Tochter treffen auf einer solchen Veranstaltung zusammen. Die geschiedene junge Frau hat zu dem Zeitpunkt bereits eine eigene, kleine Tochter.
Trotzdem verliebt sich Pham. „Ich habe nicht explizit nach einer Vietnamesin gesucht, mit der ich die Vergangenheit teile“, sagt er, „sondern nach einer Person, mit der ich meine Zukunft bauen kann.“
Mit Nguyens Tochter hat Pham heute einen kleinen Sohn. Pechschwarzes, dickes Haar und kleine Segelohren hat der 7-Jährige. Ein Kind von vielen, das ohne den Krieg, den Schmerz und die Hoffnung auf ein besseres Leben nie geboren worden wäre.
Die Zahl der Menschen mit vietnamesischem Migrationshintergrund in Deutschland ist zuletzt bis 2018 auf knapp 176.000 Personen gestiegen. Die Entwurzelung spiele für Phams Elterngeneration aber immer noch eine große Rolle.



„Wer gezwungen wird, seine Heimat zu verlassen, entwickelt schnell Verlustängste“, sagt Pham. „Viele von uns halten an dem Bild von Vietnam fest, dass sie vor vierzig Jahren in ihrem Kopf geknipst haben.“ Entsprechend bestürzt seien die ehemaligen Flüchtlinge, wenn sie das erste Mal die Wolkenkratzer in Saigon erblicken.
Bei einigen führe der Schock sogar zur Apathie gegenüber ihrem Herkunftsland. „Ich kenne einige ehemalige Flüchtlinge, die eine widersprüchliche Beziehung zu Vietnam pflegen. Sie sehnen sich nach der Kultur und reden zugleich abschätzig über die Menschen vor Ort“, sagt Pham.
Die meisten ehemaligen Boatpeople hätten außerdem keine Traumatherapie erhalten. Dies wirke sich auf die Psyche aus.
Auch Nguyen wurde nie therapiert. Die alte Dame lebt mittlerweile allein in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Vor den karg geschmückten Wänden steht ein Fernseher, mit dem sie abends Nachrichten schaut. Pham versucht, seine Schwiegermutter mit seinem Sohn so häufig wie er kann zu besuchen.
An warmen Sommerabenden sitzt die Familie im Garten bis es dunkel wird. Pham stiehlt sich spätnachts noch raus. Wenn er mit seinen Augen lange genug über den schwarzen Stadthimmel wandert, tauchen die Sterne auf.
*Name geändert
Credits
Text: Kim Ly Lam
Illustrationen: Jasper Zschörnig
Konzept & Online Produktion: Kim Ly Lam
Animation: Kim Ly Lam und Jasper Zschörnig
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Heinz Schütte und den Protagonist*innen.
Veröffentlicht am 26.03.2020
